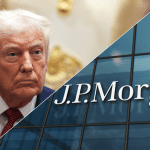Foto: July Ko/Shutterstock
Do Kwon, Gründer des kollabierten Kryptoprojekts Terra, hat nun überraschend doch seine Schuld an Betrug eingeräumt.
Es handelt sich um einen der größten Krypto-Crashs aller Zeiten: Milliarden an Wert verschwanden, und über eine Million Menschen verloren ihr Geld.
Der Gründer hatte seine Schuld stets bestritten, gesteht nun jedoch zwei Straftaten ein.
Terra-(LUNA)-Gründer bekennt sich schuldig
Das bekannte Terra-Netzwerk des Unternehmens Terraform Labs brach 2022 zusammen und traf mehr als eine Million Nutzer finanziell schwer. Der geschätzte Gesamtschaden beläuft sich auf über 34 Milliarden Euro.
Die US-Behörden ermitteln seit Jahren und haben den Gründer Do Kwon angeklagt.
Kwon hatte stets auf nicht schuldig plädiert, änderte nun aber sein Plädoyer. Er bekennt sich zu zwei Straftaten, was ihm eine Geldstrafe von über 16 Millionen Euro und bis zu 25 Jahre Haft einbringen könnte.
Die Staatsanwaltschaft empfiehlt jedoch 12 Jahre Gefängnis. Das endgültige Strafmaß wird am 11. Dezember verkündet.
Diese Vorwürfe erhebt die Anklage
Gegen Kwon liegen neun Anklagepunkte der US-Behörden vor. Zwei davon sind schwere Straftaten: Telekommunikationsbetrug und Verschwörung zum Begehen von Rohstoff-, Wertpapier- und Telekommunikationsbetrug.
Weitere Vorwürfe beinhalten u. a. Verschwörung zur Geldwäsche. Die Anklagen bestehen seit März 2023, doch erst im Januar 2025 trat Kwon erstmals vor ein New Yorker Gericht.
Kwon befand sich lange in Montenegro und wurde erst im Dezember 2024 an die USA ausgeliefert. Ein Grund für die Verzögerung ist, dass er südkoreanischer Staatsbürger ist und auch dort angeklagt wird.
Schuldbekenntnis als strategischer Schachzug
Eigentlich war erwartet worden, dass Kwon erst im Januar 2026 vor Gericht stehen würde. Dass er nun ein Schuldbekenntnis abgibt, kam für viele überraschend.
Dies könnte ein strategischer Schritt sein, um eine härtere Strafe zu vermeiden – im US-Rechtssystem nicht unüblich. Durch das Schuldbekenntnis empfehlen die Ankläger etwa eine 12-jährige Haftstrafe, während es sonst bis zu 25 Jahre hätten werden können.
Angesichts der erdrückenden Beweislage standen die Chancen auf einen Freispruch ohnehin schlecht, zumal der Fall weltweit große mediale Aufmerksamkeit erhält.
Beliebt: Krypto-Bots handeln automatisch für dich
Dein Krypto-Portfolio wachsen lassen, ganz ohne aktives Trading? Immer mehr Nutzer setzen auf automatisierte Krypto-Bots. Mit den kostenlosen Bots von OKX kannst du automatisiert am Kryptomarkt handeln. Einige Strategien erzielten in den letzten Wochen Renditen von über 190 % mit Ethereum oder XRP.
Natürlich garantieren Bots keine Gewinne, sie können aber eine sinnvolle Ergänzung deiner Trading-Strategie sein.
Extra: Melde dich noch heute für ein kostenloses OKX-Konto an und erhalte 20 € gratis Bitcoin.
Tipp: 10 € gratis Krypto bei Bitvavo
Ob XRP, Solana oder PEPE – Altcoins kommen wieder in Bewegung. Die stark wachsende europäische Kryptobörse Bitvavo ermöglicht dir einen einfachen Einstieg: Neue Nutzer erhalten 10 € Gratis-Krypto und handeln gebührenfrei bis 10.000 €.
Registriere dich noch heute und erhalte sofort 10 € Krypto deiner Wahl. Die Anmeldung ist kostenlos und in einer Minute erledigt.
👀 Ansehen & sichern